Im Juni 2005 startete mein Blog aus dem Interesse für ein neues Medium, seit Längerem ist nun schon Pause hier. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen poste ich nun auf der Facebook-Page des PR-Clusters. Blog-Beiträge gibt es dort unter dem Reiter Notizen – wir freuen uns über Besucher/innen und Beiträge.
Artikel von Alexandra Kropf
Page 3 of 40
Das Web – ein Wortmedium
Das Trend-Thema Bewegtbild mag davon ablenken, aber tatsächlich ist das Web ein textorientiertes Medium. Niemand hat das besser verstanden als Google – mit einer Suchseite frei von optischem Aufputz und vor allem mit den Google AdWords. Der Erfolg dieser reinen Textanzeigen lässt Banner-Kampagnen weit hinter sich.
Auch die Eyetracking-Studien des Poynter-Institutes belegen, dass eine Headline oft der erste Blickfang auf einer Website ist, noch vor einem Bild. Gerade für Marketing-Profis ist das oft schwer zu glauben. Die Prägung durch das traditionelle Verständnis der Print- und TV-Werbung ist so stark, dass sie stark in die Online-Welt hineinwirkt.
 Grafische Elemente haben den Vorteil, dass sie mit wenigen Fixationen erfasst werden. Dennoch werden im Web weniger als die Hälfte der angebotenen Bilder auch angesehen, schreiben Jakob Nielsen und Kara Pernice in ihrem Buch „Eyetracking Web Usability“. Screen-Auswertungen mit der Augenkamera zeigen darin sehr eindrucksvoll, wie Besucher einem Hindernisrennen gleich mit ihren Blicken um die Fotos herum auf einer Website navigieren. Zu oft haben die Bilder für den User keinen Wert: Gerade bei kleineren Fotos braucht es zu viel Aufwand, den tatsächlichen Inhalt zu entschlüsseln. Typische generische Stock-Fotos wie eines Mannes vor dem Computer oder einer freundlichen Frau mit dem Headset werden daher komplett ignoriert.
Grafische Elemente haben den Vorteil, dass sie mit wenigen Fixationen erfasst werden. Dennoch werden im Web weniger als die Hälfte der angebotenen Bilder auch angesehen, schreiben Jakob Nielsen und Kara Pernice in ihrem Buch „Eyetracking Web Usability“. Screen-Auswertungen mit der Augenkamera zeigen darin sehr eindrucksvoll, wie Besucher einem Hindernisrennen gleich mit ihren Blicken um die Fotos herum auf einer Website navigieren. Zu oft haben die Bilder für den User keinen Wert: Gerade bei kleineren Fotos braucht es zu viel Aufwand, den tatsächlichen Inhalt zu entschlüsseln. Typische generische Stock-Fotos wie eines Mannes vor dem Computer oder einer freundlichen Frau mit dem Headset werden daher komplett ignoriert.
Aber es gibt auch Fotos, die Aufmerksamkeit finden:
- Ungewohnte oder inhaltlich interessante Motive
- Bilder, die in direktem Konnex zum Inhalt stehen (das ist bei Printmedien nicht viel anders, war bei K2 schon zu lesen)
- Vor allem aber Bilder, die qualitativ hochwertig sind, ein eindeutiges Thema haben und einen hohen Kontrast aufweisen.
Meist ist ein gutes Foto in richtiger Größe besser als mehrere kleine und mittelmäßige. Soweit einige Ergebnisse aus dem neuen Buch von Nielsen und Pernice.
Ähnlich ist auch die Einschätzung von Web-Consultant Gerry Mc Govern. Seiner Meinung nach vermitteln viele Bilder auf einem Screen dem Besucher den Eindruck einer Anzeige, er will auf einer Website aber Information und nicht Werbung finden. Immer wieder zeigt sich bei Website-Projekten von Gerry Mc Govern, dass Werbebilder schlichtweg übersehen werden. So gab es auf einer Website einen Bildbanner zu einem Angebot, der 40 % des Platzes ausmachte. Zum selben Service gab es nach mehrmaligem Scrollen einen Textlink, der allerdings weit häufiger angeklickt wurde. Für die Besucher war es der schnellere Weg, weil der Banner länger zum vollen Download brauchte.
Gerry Mc Govern ist daher so etwas wie ein Prediger für guten Text auf Websites. Das heißt für ihn: Qualitätstexte so knapp wie möglich. In seinem neuen Buch The Stranger’s Long Neck“ schreibt er: „We are now told that content will be created for free by a bunch of enthusiastic amateurs. In certain cases this is true, in other cases not. It’s hard to see a bunch of enthusiastic amateurs producing animation fi lms of the same quality as Pixar’s“. Das Ergebnis im Web sind oft Seiten mit unrelevantem und ausuferndem Text, der es dem Besucher schwierig macht, die gewünschte Information zu finden: „Quality content does not increase just because you increase the amount of content created. It just becomes harder to find.“ Jeder hinzugefügte Inhalt beeinflusst die Qualität der Navigation, die Qualität der Suche und erhöht den Aufwand für das Content Management.
Tatsächlich kommt es im Web auf jedes einzelne Wort an, zumindest bei den Headlines. Die bereits erwähnten Eyetracking Studien von Pointer zeigen, dass Besucher die Headlines von links beginnend überfliegen. Wenn die ersten Begriffe einer Überschrift Interesse wecken, dann wird weitergelesen. Die ersten Wörter müssen richtige Eye-Catcher sein – „Sharp Headline Writing“ ist für das Poynter Institute daher entscheidend. Das gilt auch für die typischen Anreißer von News-Meldungen oder Intro-Absätze: Heatmaps zeigen, dass primär das linke Drittel überflogen wird.
> Mehr dazu:
Eyetracking-Studien des Pointer Institute
Headline-Tests von WhichTestWon
Buchauszug von Nielsen und Pernice (PDF)
Buchtipp: Another Book about Promotion & Sales Material
Stefan Sagmeister, erster Popstar des Grafikdesigns, stellt in einer Ausstellung samt angeschlossenem Katalog Arbeiten zwischen 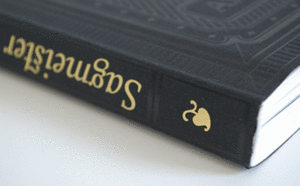 den Zuschreibungen von Kunst und Kommerz vor und lässt dabei auch Freunde zu Wort kommen. Nach vier Kapiteln gruppiert stellt „Another Book about Promotion & Sales Material“ viele beeindruckende Arbeiten vor, die Kunst, Firmen, Freunde und ihn selbst verkaufen.
den Zuschreibungen von Kunst und Kommerz vor und lässt dabei auch Freunde zu Wort kommen. Nach vier Kapiteln gruppiert stellt „Another Book about Promotion & Sales Material“ viele beeindruckende Arbeiten vor, die Kunst, Firmen, Freunde und ihn selbst verkaufen.
„Jede Beurteilung von gestalteten Produkten… ist immer auch eine Feier des eigenen Geschmacks“, schreibt Martin Heller im Buch. Meiner wurde bei vielen Arbeiten getroffen, so wie bei einer Plakatwand für Levi’s: Mehrere bewegte Zahnräder formten und veränderten den Satz „We are all workers“. Und bei einem Werbespot für eine Bank nahmen Buchstaben recht unterschiedliche Gestalten an.
Andere Zugänge zu klassischen Printmedien
Interessant ist die Dominanz der klassischen Printmedien Buch und Zeitung: So hat Sagmeister für die Columbia University mehrere Jahrbücher gestaltet – darunter eines ohne Anfang und Ende. Das erinnerte mich an ein Seminar bei Mario Pricken, bei der wir in einer Kreativ-Session Roh-Ideen für Nicht-Broschüren sammelten, um neue Zugänge zu einem altgedienten Instrument zu finden. Auch hier entstand manch ähnliche Idee. Aber wie schreibt Marian Bantjes im Buch: „Ideen gibt es wie Sand am Meer; wir sind alle Ideenmenschen … doch diese Kombination aus nicht nur guten, sondern tollen Ideen mit brillanter Ausführung ist bemerkenswert selten.“ Sagmeister kann hier enorme Verve entwickeln bis hin zur Obsession. So entstand aus 250.000 Eurocents-Münzen im Laufe von acht Tagen ein Straßenbild mit dem Satz „Obsessions make my life worse and my work better“.
Die Ausstellung mit Sagmeisters Arbeiten war zunächst in Lausanne zu sehen und wird jetzt bis Feber 2012 im Museum “Les Arts Décoratifs“ in Paris gezeigt.
Sagmeister: Another Book about Promotion & Sales Material. 176 Seiten. Verlag Hermann Schmidt Mainz. 2011. 29,80 EUR
Mehr dazu:
Beitrag zum Thema „Nicht-Broschüren“ beim Blog K2
Bildquelle: Verlag Hermann Schmidt Mainz
Das Fahrpersonal und die Tücken des Gender Mainstreaming
‚Während der Fahrt nicht mit dem Fahrpersonal sprechen‚, las ich letztens in einer Straßenbahn. „Das ist wieder typisches Bürokratendeutsch“, dachte ich, ‚warum steht da nicht einfach ‚Fahrer‘?‘ Doch da klingelte es bei mir: Bei den Wiener Linien hatte Gender Mainstreaming Einzug gehalten.
Schon meldeten sich zwei Seelen in mir zu Wort: Einerseits ist eine geschlechtsneutrale Sprache ein echtes Thema. Frauen fühlen sich eben nicht angesprochen , wenn sie bloß „mitgemeint“ sind. Ausreichend Studien belegen, dass rein männliche Formen beispielsweise bei Bewerbungen nachteilige Folgen haben.
Andererseits sollen Texte uns berühren – nichts tut das weniger als derart abstrakte Begriffe. Und so legt mein innerer Text-Profi bei solchen Begriffen wie ‚Fahrpersonal‘ ein Veto ein. In Wirklichkeit sprechen sie niemanden mehr an, weder Frau noch Mann. Das kann nicht die Lösung sein.
Wir stehen bei diesem Thema allerdings nicht mehr am Beginn, sondern sind bereits inmitten eines Prozessen. Ein Blick zurück und ein willkürliches Beispiel mögen zeigen, dass sich bei der Geschlechtersensibilität bereits viel bewegt hat: Ganz selbstverständlich wurde Helene Partik-Pablé 1980 vom Wirtschaftsmagazin trend zum „Mann des Jahres“ gewählt. Erst Heide Schmidt 1993 durfte diesen Titel als „Frau des Jahres“ erringen.
Das gesellschaftliche Grundverständnis hat sich enorm verändert. Parallel dazu entwickelten sich viele Formen, beide Geschlechter anzusprechen: großes Binnen-I („FahrerIn“) , Schrägstrich („Fahrer/in“), Klammer („Fahrer(in)“) oder die ausführliche Form („Fahrerin und Fahrer“). Und was sagt der Duden zu dieser Entwicklung? Schreibweisen mit Großbuchstaben im Wortinneren sind bei den Sprachwächtern generell verpönt. Klammer und Schrägestrich sind demnach das richtige Mittel der Wahl, wenn man dudengemäß und geschlechtergerecht schreiben möchte.
All diese Formen haben einen Nachteil gemeinsam: Sie sind umständlicher und machen Texte sperriger. Oft wird es daher Sinn machen, eine andere Form zu suchen. Gerade hier sind Text-Profis gefragt. Vielleicht kann ein Satz wie in den Wiener Straßenbahnen ja auch heißen:
Bitte denken Sie daran:
Wer fährt, kann nicht mit den Fahrgästen sprechen.
Es ist ein anderer Weg zur selben Botschaft. Sicher, vieles andere ist möglich und tatsächlich glaube ich, dass uns das Thema Gender Mainstreaming noch länger beschäftigten wird. Wir werden uns diese neue, geschlechtergerechte Sprache erst erarbeiten. Aber wir sind auf gutem Weg – und die Sprache hat immer noch jene Form gefunden, die von den Menschen ihrer Zeit gefragt war.
Mein erster Schritt wird sein, dass ich dem geschlechtergerechten Schreiben hier auf diesem Blog künftig mehr Aufmerksamkeit schenken werde.
> Mehr Information:
Praktikable Regen für geschlechtergerechtes Formulieren: Sprachleitfaden des Landes Niederösterreich (PDF)
Der eigenen Kreativität auf der Spur
 Wie entsteht Kreativität? Jeder, der schon frustrierende Brainstorming-Sitzungen erlebt hat, mag seine eigenen diesbezüglichen Fähigkeiten in Zweifel ziehen. Und wollte doch nur mit dem falschen Weg das richtige Ziel erreichen. Denn kaum ein Instrument erweist sich als so wenig tauglich, kreative Prozesse in Gang zu bringen wie Brainstormings.
Wie entsteht Kreativität? Jeder, der schon frustrierende Brainstorming-Sitzungen erlebt hat, mag seine eigenen diesbezüglichen Fähigkeiten in Zweifel ziehen. Und wollte doch nur mit dem falschen Weg das richtige Ziel erreichen. Denn kaum ein Instrument erweist sich als so wenig tauglich, kreative Prozesse in Gang zu bringen wie Brainstormings.
Warum sie dennoch nach wie vor zum Standard-Repertoire gehören? Weil Brainstormings auch einfach sind. Wer so mit dem Tagesgeschäft blockiert ist, dass keine Zeit bleibt, um von Grund auf Neues zu denken und zu entwickeln, der greift gerne zur wenig anstrengenden Notlösung: Ohne aufwändige Vorbereitung sitzt man einfach zusammen. Was so entsteht, sind Pseudo-Ideen und Aktionismus.
Mehr Heartstormings statt Brainstormings wünscht sich daher Gunter Duenk und stellt sich die Gretchenfragen: „Warum bereiten wir uns nicht vor? Warum arbeiten wir uns nicht vorher in die Problematik ein? Warum bringen wir nicht schon gute Ideen mit? Warum dürfen alle bei neuen Ideen mitmachen? Warum nicht nur die, die so etwas können und am besten ihre Fähigkeiten schon bewiesen haben? (Viele Kochlehrlinge verderben nicht nur den Brei, sie reden nur welchen.) Warum scheiden wir nicht schon vor dem Meeting unsinnige Ideen aus und reden nur über die, die es wert erscheinen?“ Und Kreativitätstrainer Mario Pricken kennt gleich
elf Gründe, die gegen Brainstormings sprechen, von denen hier zwei zitiert seien:
Nummer 1: „Weil die Teilnehmer kein Wissen über den Kreativprozess oder kreative Denkstrategien besitzen und sich stattdessen zu 100 % auf ihre Intuition und Tagesverfassung verlassen müssen.“
Nummer 8: „Weil bereits tausende Menschen tausende Stunden vor Ihnen über das Thema nachgedacht haben. Freies Assoziieren, wie es im Brainstorming erfolgt, produziert meist nur leicht variierte Klischees. Für die Big-Idea sind gut präpariertes Material, tiefgreifendes Wissen und ungewöhnliche Methoden notwendig.“
Wie entstehen also Geistesblitze wirklich? Wie wird man zum kreativen Genie? Journalist und brand eins-Gründer Wolf Lotter gibt dazu eine wenig erfreuliche Bestandsaufnahme: Unser Wertekanon ist primär auf das Reproduzieren von Bestehendem ausgerichtet, Dinge sollen planvoll nach Mustern und Methoden gelöst werden, Abweichungen vom Mittelmaß werden nicht akzeptiert. Zugleich erleben wir heute aber eine entscheidende Entwicklung: Immer mehr Menschen arbeiten in Berufen, in denen Kreativität gefragt ist, Erfolg hat künftig, wer die besten Ideen hat.
Was also tun, wenn Kreativität immer mehr zur allgemeinen Erfolgsformel wird? Mehr Wissen über das Funktionieren kreativer Prozesse tut not. Zentral dabei ist das Konzept des Flow, vom Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi: ein Zustand konzentrierter, schöpferischer Aktivität, in dem man völlig in seiner Tätigkeit versunken ist. Abseits jeglichen Zwangs und störender Außenfaktoren finden Aufmerksamkeit und Motivation zu einer produktiven, spielerischen Harmonie zusammen. Jeder hat solche Momente bereits erlebt, in denen er mit Spaß an der Sache etwas Gutes, Erfolgreichs entwickelte – und war damit kreativ.
Was kann man also tun, um solche Momente bewusst zu erreichen? Zunächst sind die Außenfaktoren wesentlich: Ruhe, kein Zwang, eine Umgebung, in der man gut und gerne arbeitet. Und dann gibt es bewährte Wege und Instrumente, die es zu erproben gibt. Denn jeder hat ein Stück weit einen individuellen Zugang, um gute Ideen zu entwickeln.
Dazu fünf Tipps als erste Fährte auf der Spur zur eigenen Kreativität:
- Den Kreativitätstrainer Mario Pricken habe ich bereits erwähnt. Er ist Autor des Standard-Werkes Kribbeln im Kopf, das gleich mehrere sinnvolle Methoden beschreibt.
- Malcom Gladwell ist Journalist beim New Yorker und beschäftigt sich in seinen Büchern unter anderem damit, was gute, erfolgreiche Ideen ausmacht.
- Die Kreativitätstrainerin Anja Ebertz sagt: “Das Gehirn kann nicht aus Nichts etwas schaffen, ist aber exorbitant gut im Kombinieren. Das Geheimnis der Kreativität ist das flüssige Denken.” Um das in Gang zu setzen, empfiehlt sie einen vierstufigen kreativen Prozess.
- Sehr bekannt ist mittlerweile das Konzept des Mind Mapping von Tony Buzan. Um eigene Ideen zu entwickeln, empfiehlt sich das Arbeiten auf einem großen Bogen Papier. Mindmap-Computerprogramme sind primär als Orginisationstool hilfreich.
- Gute Anstöße gibt schließlich auch das Buch „Der Weg des Künstlers im Beruf“ von Mark Bryan. Es begleitet als mehrwöchiger Kurs auf eine Entdeckungsreise zur eigenen Kreativität.
Blick ins Buch: Klardeutsch
Über Neuromarketing erschienen in der letzten Zeit viele Bücher. Markus Reiter untersucht in seinem Buch, was wir aus der Gehirnforschung speziell für das Halten von Reden und das Schreiben von Texten lernen können – inklusive so manchem Aha-Effekt: Jeder kennt zum Beispiel das Problem, dass ein Wort auf der Zunge liegt, aber nicht über die Lippen kommen möchte.
Priming – der Wort-Supermarkt im Kopf
Das führt direkt zum wichtigen Thema Primimg: Unser Gehirn speichert Wörter wie einem Supermarkt nach Themen geordnet. Unser Hirn hat es daher leichter, wenn ein Text in einem Wortfeld bleibt. Ebenso gilt: Durch positive Wörter werden positiv besetzte Wortfelder und angenehme Assoziationen aufgerufen. Aber Achtung: Zu viel Priming macht einen Text langweilig. Daher ist in Maßen gefragt, ungewöhnliche Wörter einzustreuen.
Klardeutsch beschäftigt sich auch mit der Konnotation von Wörtern. Es treten hier drei Gegensätze auf: gut gegen böse, schwach gegen stark und aktiv gegen passiv. Diese emotionalen Wertungen erfolgen primär im limbischen Gehirn, der Zugriff auf diese Areale geschieht willkürlich. Die sachliche Bedeutung ist demgegenüber in der linken Hemisphäre des Cortex angesiedelt. Interessant ist auch: Es macht einen Unterschied, wie geläufig ein Wort ist. Selbst gebildete Menschen haben bei seltenen Fachwörtern eine verzögerte Worterkennung.
Konkrete Texte erzeugen Neuronenfeuer
Außerdem zeigt sich, dass konkrete Begriffe deutlich mehr neuronale Aktivitäten erzeugen. Anhäufungen abstrakter Begriffe führen dazu, dass sich Zuhörer schon nach kurzer Zeit nicht mehr an einen Text erinnern können. Sinnvoll sind abstrakte Begriffe, wenn sich Zuhörer bewusst keine Vorstellung machen sollen. So mag es ratsam sein, von toxischen Emissionen anstatt von Giftausstoß zu sprechen. Eines ist jedoch wichtig: Die zentrale Aussage gehört immer in Worte gekleidet, die emotional positiv belegt sind.
Für mich als Texterin findet sich im Buch vieles, was ich bei meiner Arbeit schon des längeren beachte. Erinnern tut aber immer gut, vor allem aber ist es interessant zu erfahren, warum wir Texte und Wörter eben genauso aufnehmen und verarbeiten. Was mitunter zufällig erscheinen mag, folgt in Wirklichkeit klaren Regeln. Schließlich gefällt mir im Buch auch, dass Markus Reiter die Erkenntnisse der Hirnforschung selbst umsetzt – mit einem sehr schlüssigen Aufbau und einer Zusammenstellung der wichtigsten Aussagen je Kapitel.
Markus Reiter. Klardeutsch. Neuro-Rhetorik nicht nur für Manager
Carl Hanser Verlag GmbH & CO. KG, 2. Auflage 2010, 254 Seiten
Das Smartphone ändert das Handy-Profil
Die deutsche Variante der Kommunikationszeitung Horizont stellt in der aktuellen Ausgabe Nutzungszahlen zum mobilen Internet vor. Aus den Jahresvergleichen zwischen 2010 und 2011 lässt sich sehr gut ersehen, welche Zusatzfunktionen sich am Handy wirklich durchsetzen. Kamera und MP3-Player sind zwar nach wie vor wichtige Funktionen, werden jetzt aber seltener verwendet als noch im Frühjahr 2010: 18,6 % (= – 4,5 %) nutzen derzeit ihre Kamera häufig, 17,7 % (= -2,6%) den MP3-Player.
Stark am Vormarsch sind Internetsurfen mit 17,5 % (=+7,7 %) und E-Mail-Dienste mit 13,8 % (= +4,5 %). Eindeutig wichtigste Funktionen sind nach wie vor SMS/MMS mit 33,8 % (= -2,5 %) und der Organizer mit 33,8 % (= -0,6 %). Wer vom Handy E-Mails versendet, arbeitet offensichtlich weniger mit SMS.
Datenkrake Facebook
600 Millionen Menschen sind bereits auf Facebook, in zwei Jahren könnte es eine Milliarde sein, schreibt profil in der Cover-Story der heutigen Ausgabe. Hierzulande sind laut Social Media Radar Austria bereits 1,1 Millionen ÖsterreicherInnen aktiv.
Facebook kennt aber noch viel mehr. Ich war echt beklommen, als ich ein Einladungs-Mail an ein Nicht-Facebook-Mitglied sah: Unter der Einladung selbst waren da mehrere weitere Personen aufgelistet, die schon bei Facebook registriert sind. Die Vorschläge waren alle echte Treffer – und kamen aus unterschiedlichem beruflichem und privatem Kontext.
Ganz ohne eigenem Zutun ist man bei Facebook alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Das stimmt nachdenklich, ebenso wie viele andere Aktionen – das Mittracken von Mails, die über GMX versendet werden, oder das Scannen des eigenen Surfverhaltens durch Social Plugins. Nutzerdaten werden jetzt auch ohne Zustimmung an Partner wie Bing weitergegeben, ist in einer neuen Serie auf Futurezone.at zu „Inside Facebook“ zu lesen.
Aber es gibt Möglichkeiten einzugreifen: Das IT-Magazin c’t beschreibt in der ersten Ausgabe 2011 in einem eigenen FAQ-Artikel ausführlich, worauf zu achten ist und was man tun kann, um sich die gewünschte Privatsphäre zurückzuerobern.
Eine Broschüre ist (k)eine Broschüre
Bei einem Seminar mit Mario Pricken vor einiger Zeit beschäftigte uns auch das Thema Broschüre: Sehr oft ist sie einfach so etwas wie ein Gewohnheits-Instrument – ein Basis-Tool, das man ganz automatisch produziert. Aber machen wir die Empfängerinnen und Empfänger damit auch immer glücklich?
Wir haben im Seminar typische Merkmale einer Broschüre definiert – und sie dann ins Gegenteil verkehrt. Ich fand diese Übung für die eigene Arbeit sehr erhellend. In fünf Gruppen entstanden da viele unterschiedliche Rohideen zu Nicht-Broschüren. Und sehr viele davon waren unglaublich spannend. Wahrscheinlich würden solche Nicht-Tools oft deutlich mehr Response zeigen als die klassischen Werbemittel, die wir fast schon gewohnheitsmäßig produzieren.
SOS Weihnachten
Noch schnell ein Geschenk für einen Kunden? Und die Weihnachtspost ist auch noch nicht erledigt? Nicht immer kommen die besten Ideen spontan, wenn die Zeit schon drängt. Etwas Inspiration tut also gut!
Zum Thema Geschenke mag ein Blick auf die typischen Wunschzettel von Frauen und Männern hilfreich sein. Die sind deutlich verschieden, hat Direct Point der Schweizer Post herausgefunden:
Die häufigsten Wünsche von Männmern (und was geschenkt wird)
Die häufigsten Wünsche von Frauen (und die tatsächlichen Geschenke)
Trotz E-Mail ist die klassische Weihnachtspost nach wie vor sehr beliebt. Auch wenn wir es ansonsten nicht mehr tun: Einmal im Jahr schreiben wir Grüße gerne noch auf Papier und verschicken sie traditionell mit der Post. Anscheinend tun wir das weit ausgiebiger als es der Post selbst lieb ist, denn die bietet jetzt eine E-Postkarte des Christkindls an.
Die Agentur Script hat 2009 Unternehmen in Deutschland zum Thema Festtagspost befragt. 60 Prozent der TeilnehmerInnen verschicken laut dieser Umfrage eine individuell gestaltete Weihnachtskarte auf Papier, nur 15 Prozent begnügen sich mit einer E-Card.
Noch mehr Daten gibt es auf dem Blog meiner deutschen Kollegin Kerstin Hoffmann: Sie befragte heuer, womit man Geschäftspartner üblicherweise bedenkt – und worüber man sich selbst freut. Auch hier wieder ein klares Ja zur Weihnachtskarte – und auch zur Unterstützung sozialer Organisationen. Solch ein Zeichen ist auch mir wichtig. In einem Jahr, in dem achtjährige Mädchen als Gefahr für die innere Sicherheit unseres Landes galten und humane Abschiebung zum Unwort 2010 wurde, kann ich mir kaum ein besseres Ziel vorstellen als das Integrationshaus.